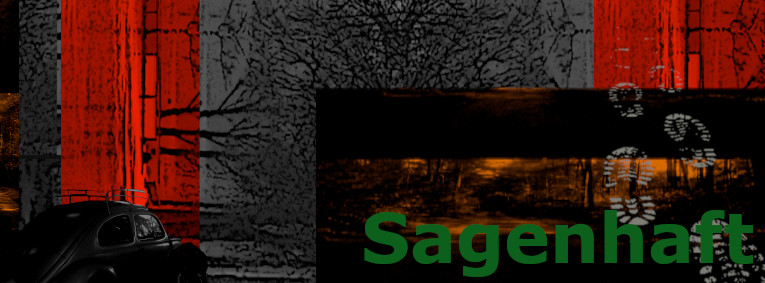Dunkle Wesen der Germanen
Die Datenlage der frühen Germanen ist sehr spärlich, dennoch versucht dieser Artikel plausible Schlussfolgerungen zwischen den frühen Germanen und der nordischen Mythologie zu ziehen. In einigen Aussagen finden sich Spekulationen, die sich auf Indizien stützen, für die jedoch keine exakten Belege vorliegen.
Die Angst vor dem Tod – und vor dem, was danach kommt – begleitet die Menschheit seit jeher. Für die Germanen war der Tod jedoch nicht das Ende, sondern der Übergang in eine andere Existenz. Dieser Übergang war jedoch nicht immer friedlich – einige Tote kehrten zurück, und diese Rückkehr war oft von unheilvollen Wesen begleitet. In den germanischen Mythen und Sagen finden sich Vorstellungen von Toten, die wieder auferstanden sind, sei es als Rachegeister oder durch magische Kräfte, die mit der Natur verbunden waren. Die Menschen fürchteten diese unheimlichen Wesen zutiefst: Sie bangten vor dem Treiben des Toten, der Bedrohung durch das Übernatürliche und der Gefahr, selbst verflucht zu werden.
In diesem Artikel erwartet dich:
Frühe germanische Mythen: Der Tod als Übergang
Verbindung zu den nordischen Mythen: Draugar und Wiedergänger
Werwölfe und Berserker: Verwandlung und ihre Bedeutung
Rachegeister und ruhelose Seelen: Der Fluchglaube
Fazit: Die Entwicklung der frühgermanischen Mythen zu den nordischen Sagen
Frühe germanische Mythen: Der Tod als Übergang
Es ist nicht genau überliefert, welche konkreten Vorstellungen über das Jenseits bei den frühen Germanen vorherrschten. Einige Forscher vermuten, dass die frühen Germanen eine komplexe Vorstellung vom Leben nach dem Tod hatten, die je nach Region variierte. Die Vorstellung einer Art Totengöttin sowie des Krieger-Jenseits ist in vielen germanischen Kulturen verwurzelt, allerdings gibt es regionale Unterschiede bei den Stämmen. Die Idee, dass Krieger nach dem Tod in eine besondere Spähre gelangen, könnte älter sein, während die Jenseitsvorstellungen zu der Totengöttin Hel, Valhall* oder Fólkvangr (Freijjas Halle) bereits früh in der nordischen Mythologie verankert sind. Eine der wichtigsten Quellen bildet die Edda mit ihren zahlreichen Geschichten und Liedern.
*„valr“ bedeutet „Gefallene“ oder „Schlachtfeld“. Es stammt von „valr“, was „die Toten“ oder „die Gefallenen“ im Kampf bezeichnet.„hall“ bedeutet „Halle“, also ein großes Gebäude oder eine Halle.
Altnordische Mythologie
Die altnordische Mythologie enthält bereits Jenseitsvorstellungen, die in der Edda erwähnt werden: Die Totengöttin Hel, die das Totenreich regiert und die, die Seelen derer aufnimmt, die nicht im Kampf gefallen sind, oder Valhall, wo die Seelen der gefallenen Krieger empfangen werden. Fólkvangr (Freijjas Halle), wo die Hälfte der gefallenen Krieger ankommt, ist auf wenige Verse in der Grímnismál** begrenzt. Laut der nordischen Mythologie wurde ein ehrenhafter Krieger (Einherjer), der im Kampf gefallen war, von den Valkyrien nach Valhall gebracht, der Halle des Göttervaters Odin. Dort durfte der Krieger weiterleben und an den endlosen Kämpfen teilnehmen. Doch nicht alle Seelen fanden dort Einlass, die Hälfte wurde von den Valkyrien*** nach Fólkvangr zu Freyja gebracht. Was aber geschah mit denen, die keine Ruhe fanden? Ihre Seelen konnten in eine andere, dunkle Existenz übergehen – als ruhelose Geister oder gar als Rachegeister.
**Das „Grímnismál“ ist ein Gedicht aus der „Edda“, in dem Odin, unter dem Namen Grímnir, in einem Dialog mit dem König Geirröðr Wissen über die neun Welten, die Götter und das nordische Universum teilt, wobei es zentrale Informationen zur nordischen Kosmologie und Götterwelt vermittelt.
***Valkyrien sind in der nordischen Mythologie weibliche Geister oder Kriegerinnen, die im Auftrag von Odin die tapfersten Krieger auswählen, die im Kampf gefallen sind, und sie nach ihrem Tod in die Halle Valhall führen, wo sie für das Ragnarök vorbereitet werden.
Frühe Mythen
Frühe Mythen und die Edda geben vage Hinweise auf Wesen, die mit der Auferstehung der Toten und ihrer Rache in Verbindung stehen. Aber eine explizite Darstellung von Rachegeistern und Wiedergängern ist nicht zentral. Diese Wesen, die zum Teil aus der Vorstellung von unvollständig oder falsch bestatteten Toten hervorgegangen sind, zeigen bereits Ansätze der späteren nordischen Draugar und Wiedergänger, die in den späteren Sagas und der Folklore eine größere Rolle spielen werden.
Noch heute finden wir in den klassischen Geschichten verschiedene Verbindungen zu unserer modernen Erzählweise. In meinem Artikel „Von Zeus bis Zombie – Klassische Erzählungen in modernen Zeiten“ erfährst du mehr.
Verbindung zu den nordischen Mythen: Draugar und Wiedergänger
Während die frühgermanischen Mythen bereits erste Elemente von Wiedergängern oder Rachegeistern kennen, sind es vor allem die späteren nordischen Sagen und Folklore, die diese Wesen in einem stärker ausgeprägten, unheimlichen Kontext darstellen. In der nordischen Mythologie sind Draugar (singular Draugr) körperlich auferstandene Tote, die oft Gräber oder Schätze bewachen. Ihre Aufgabe war es, die eigenen Gräber oder Schätze zu beschützen – oft mit Gewalt, wenn Eindringlinge versuchten, den Schatz zu stehlen. Sie wurden als unheimlich mächtige Wesen beschrieben, die in ihren Grabhügeln ein unheimliches Leben führten.
In anderen Deutungen wurden sie als unheimliche, mächtige Wesen beschrieben. Ebenso gibt es Beschreibungen, in denen Draugar oft eine dämonische oder gespenstische Präsenz besaßen und mit einer „unheimlichen“ Kraft zurückkehrten – Ihre Geschichten spiegeln die Angst vor der Wiederkehr der Toten wider. Ihre Geschichten spiegeln die tief verwurzelte Angst der Germanen vor der Wiederkehr der Toten wider.
Die Vorstellung, dass der Tod nicht immer das Ende, sondern auch der Beginn einer neuen, unheimlichen Existenz sein kann, spiegelt sich sowohl in den germanischen als auch in den nordischen Mythen wider. In beiden Kulturen gab es die Furcht vor der Wiederkehr der Toten, die keinen Frieden gefunden hatten. In der nordischen Sagenwelt wurde diese Vorstellung weiterentwickelt, indem Draugar und Wiedergänger nicht nur Rache übten, sondern auch die Lebenden bedrohten.
Werwölfe und Berserker: Verwandlung und ihre Bedeutung für die Germanen
Ein weiterer Aspekt, der in den germanischen Mythen eine Rolle spielt, ist die Verwandlung von Menschen in Tiere – ein Motiv, das später in der Werwolfsagenwelt weiterentwickelt wurde. Die Berserker der nordischen Welt, die für ihre unbändige Wut bekannt waren, kämpften in einem fast animalischen Zustand. Diese Krieger galten als in gewisser Weise mit dem Tierreich verbunden, da sie im Kampf die wilden Instinkte von Tieren annehmen sollten. Vorstellbar wäre, dass sie Wolfspelze oder Bärenfelle trugen, um die Kräfte der Tiere auf sich zu übertragen. Diese Tierverwandlungen in einem rituellen, spirituellen Kontext weisen starke Parallelen zu den späteren Werwolfmythen der Folklore und des Mittelalters auf, auch wenn keine physische Verwandlung stattgefunden hat.
Obwohl die Menschen den modernen Mythos des Werwolfs – eines Menschen, der durch einen Fluch oder Zauber zum Wolf wird – eher der späten Folklore und der mittelalterlichen Vorstellungswelt zuordnen. Diese frühen Vorstellungen sind von Tierverwandlungen tief in den germanischen und insbesondere den nordischen Kulturen verwurzelt. Die nordischen Sagen erzählen oft von Kriegern, die sich im Kampf wie Tiere verhielten. Diese frühen Wolfskrieger, wie die Ulfhednar, könnten eine Inspirationsquelle für die spätere Entwicklung des Werwolfglaubens gewesen sein.
Wie wirklich der Glaube an Werwölfe für die Menschen in der frühen Neuzeit und im Mittelalter war, zeigt der Fall Peter Stumpf. Sein dokumentierter Werwolfprozess von 1589 in Deutschland. Peter Stumpf war angeklagt, der „Werwolf von Bedburg“, ein Werwolf zu sein. Ihm wurden zahlreiche Morde zur Last gelegt, darunter auch die Tötung von Kindern und Tieren. Unter der Folter gestand Peter Stumpf, sich in einen Wolf verwandeln zu können, woraufhin er zum Tode verurteilt wurde. Ihm wurden die Hände abgehackt und das Herz herausgerissen, bevor er verbrannt wurde. Sein Fall gehört zu den bekanntesten Werwolfsprozessen Deutschlands und belegt, wie real die Angst der Menschen vor dem Werwolf war.
Rachegeister und ruhelose Seelen: Der Fluchglaube der Germanen
Die Vorstellung von Rachegeistern ist ein weiteres wiederkehrendes Motiv in den frühgermanischen Mythen. Der Fluch eines zu Unrecht Getöteten oder eines unvollständig Begrabenen führte oft dazu, dass er als Geist zurückkehrte, um Rache zu üben. Die nordische Folklore beschreibt oft Geister als ruhelose Seelen oder Wiedergänger, die die Lebenden oft als großes Übel empfanden. Die Wiedergänger kehrten oftmals zurück, um ihre Taten zu vollenden. Ihre Rückkehr konnte aus Rache oder einer ungelösten Aufgabe bestehen.
In der frühgermanischen Welt betrachteten die Menschen den Tod vermutlich nur als Beginn einer neuen Existenz, und sie behandelten die Toten oft mit großem Respekt, um ihre Rückkehr in irgendeiner Form zu verhindern. Fürchtete man dennoch die Wiederkehr, so gab es zahlreiche Schutzmaßnahmen. Als besonders wirksam galt das Pfählen. Dabei wurde ein spitzer Pfahl durch den Körper des Toten getrieben, um seine Rückkehr zu verhindern.
Das Einlegen von Steinen in den Mund des Toten sollte verhindern, dass der Tote schreien, sprechen oder Flüche murmeln könnte. Auch die Bestattung in besonders tiefen oder abgelegenen Gräbern sollte die Seele des Verstorbenen daran hindern, aus dem Grab zu steigen. Derartige Bestattungen kommen auch in slawischen, keltischen oder späteren mittelalterlichen Kontexten vor. Ob ein Zusammenhang derselben Interpretation angenommen werden kann, ist fraglich. Ziemlich sicher ist, dass die Menschen diese Vorstellungen in der späteren nordischen Folklore verfeinerten und die Geschichten über Wiedergänger und Draugar an Beliebtheit gewannen.
Fazit: Die Entwicklung der frühgermanischen Mythen zu den nordischen Sagen
Die frühgermanischen Mythen legten den Grundstein für viele der späteren nordischen Vorstellungen von Werwölfen, Draugar und Wiedergängern. Es gibt Hinweise, dass es in der frühgermanischen Welt bereits Vorstellungen über den Tod und die Möglichkeit, dass die Toten zurückkehren könnten, gab. Sei es als Rachegeister oder durch unvollständige Bestattungen. Diese Vorstellungen wurden in den nordischen Sagen weiter ausgebaut, sodass die späteren Werwölfe und Draugar direkt auf diese frühen Mythen zurückgehen.
Die nordischen Mythen entwickelten die Vorstellung von ruhelosen Toten, die in eine neue Existenz übergehen. Diese konnten sowohl die Lebenden bedrohen als auch ihre unerledigten Aufgaben vollenden. Das Bild des Werwolfs, der von der menschlichen Gestalt in die eines wilden Tieres übergeht, und die Draugar als körperlich auferstandene Totenkrieger spiegeln die alten Ängste der Germanen vor der Wiederkehr der Toten und vor der Macht, die der Tod über das Leben der Lebenden haben kann.
Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Das Kommentarfeld findest du unter der Postvorschau. Ich freue mich, von dir zu lesen. Deine Ellie